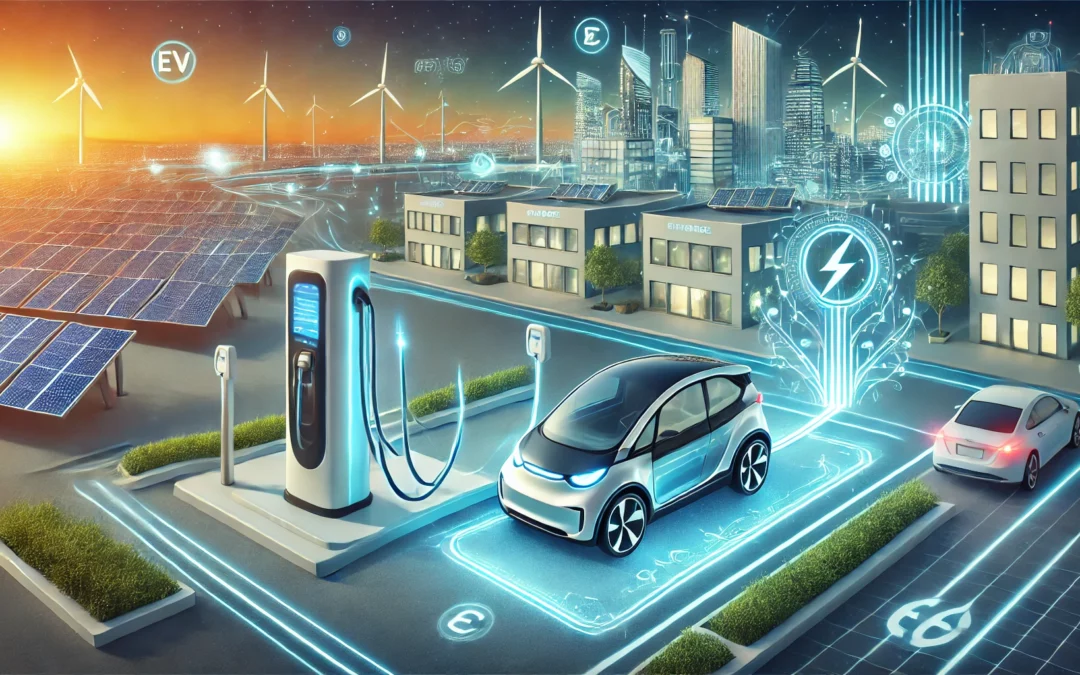Stell dir vor, dein Elektroauto ist nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern auch Teil eines intelligenten Stromnetzes. Es lädt sich bei Überschuss im Netz – etwa bei viel Sonne oder Wind – auf und speist Energie zurück, wenn der Bedarf steigt. Dieses Konzept nennt sich Vehicle-to-Grid (V2G) – und während Deutschland noch mit Pilotprojekten experimentiert, startet China 2025 mit über 30 groß angelegten V2G-Initiativen.
Die Idee ist ebenso genial wie einfach: E-Autos werden zu mobilen Stromspeichern. Sie stabilisieren das Stromnetz, machen Erneuerbare planbarer und eröffnen neue Geschäftsmodelle. In diesem Beitrag zeigen wir, warum China beim bidirektionalen Laden weltweit führend ist, wie Elektroautos als Stromspeicher funktionieren und was das für V2G in Deutschland bedeutet.
Was ist Vehicle-to-Grid (V2G)?
Vehicle-to-Grid bedeutet, dass ein Elektrofahrzeug nicht nur Strom vom Netz empfängt (Laden), sondern auch Strom in das Netz zurückspeisen kann (Entladen). Diese Technologie basiert auf sogenanntem bidirektionalen Laden.
Das Elektroauto kommuniziert mit dem Netzbetreiber oder einem Energieaggregator. Wenn zu viel Strom im Netz vorhanden ist (z. B. mittags bei starker PV-Produktion), wird geladen. Bei Stromknappheit (abends, windstille Tage) kann das Fahrzeug Energie zurückspeisen – gegen Vergütung.
Bidirektionales Laden China: Warum China weltweit vorne liegt
China hat früh erkannt, dass Elektromobilität nicht nur emissionsfreies Fahren bedeutet, sondern auch ein Schlüssel zur Energiesicherheit ist. Das Land hat über 15 Millionen E-Fahrzeuge auf den Straßen – mehr als jedes andere Land – und treibt 2025 mehr als 30 großflächige V2G-Projekte in urbanen Regionen, Industrieparks und Wohngebieten voran.
Einige Gründe für den Vorsprung:
- Standardisierung: Die chinesische Regierung fördert landesweit einheitliche V2G-Kommunikationsstandards (GB/T)
- Staatliche Förderung: Energieversorger und Fahrzeughersteller erhalten Subventionen für V2G-Infrastruktur
- Integrierte Hersteller: BYD, NIO, XPeng und GAC bauen eigene V2G-fähige Fahrzeuge und Ladegeräte
- Netzarchitektur: Das chinesische Stromnetz ist für dezentrale Speicher besser ausgelegt als viele europäische Systeme
Das Ergebnis: Bereits 2024 gibt es in Metropolen wie Shenzhen, Guangzhou und Hangzhou bidirektionale Ladeparks mit mehreren Hundert Ladepunkten – oft öffentlich zugänglich.
Elektroauto Stromspeicher: So funktioniert V2G technisch
Für Vehicle-to-Grid braucht es mehr als nur ein E-Auto mit Batterie. Drei Voraussetzungen sind entscheidend:
1. V2G-fähiges Auto
Das Fahrzeug muss einen bidirektionalen Onboard-Charger besitzen. Viele Modelle aus China – etwa der BYD Atto 3 oder der NIO ET5 – sind bereits serienmäßig V2G-kompatibel.
2. V2G-Ladestation
Normale Wallboxen reichen nicht aus. Es wird eine bidirektionale Ladestation benötigt, die Strom in beide Richtungen sicher steuern und kommunizieren kann. In China sind diese Ladegeräte inzwischen weit verbreitet – in Deutschland dagegen selten.
3. Intelligentes Energiemanagement
Das Herzstück ist die Steuerung. Ein Energiemanagementsystem (EMS) entscheidet, wann geladen oder entladen wird – je nach Netzbedarf, Strompreis oder Nutzerpräferenz.
Use Cases: Wie V2G in China bereits genutzt wird
Chinesische Energieversorger setzen Vehicle-to-Grid heute schon in mehreren Bereichen ein:
- Spitzenlastabdeckung: E-Autos speisen Strom ins Netz ein, wenn Industriebetriebe hohe Lasten verursachen
- Integration erneuerbarer Energien: PV- und Windstrom wird mittags gespeichert und abends wieder abgegeben
- Notstromversorgung: In Katastrophenfällen dienen Fahrzeuge als mobile Powerbanks (z. B. bei Stromausfällen)
- Virtuelle Kraftwerke: Flotten werden gebündelt und als kollektiver Energiespeicher am Markt gehandelt
Beispiel: In Shanghai betreibt State Grid einen V2G-Testpark mit 500 Fahrzeugen. Erste Analysen zeigen: Nutzer können jährlich bis zu 1.200 € an Netzdienstleistungen verdienen – allein durch intelligentes Laden und Entladen.
V2G Deutschland: Woran es noch scheitert
Auch in Deutschland wird Vehicle-to-Grid getestet – etwa bei E.ON, BMW, The Mobility House oder EnBW. Doch im internationalen Vergleich steht V2G in Deutschland noch ganz am Anfang.
Herausforderungen in Deutschland:
- Keine einheitlichen Standards: Unterschiedliche Protokolle erschweren die Systemintegration
- Fehlende Infrastruktur: Bidirektionale Wallboxen sind teuer und kaum verfügbar
- Rechtliche Unsicherheiten: Wie wird rückgespeister Strom steuerlich behandelt? Wer haftet?
- Fehlende Vergütungsmodelle: Aktuell gibt es keine wirtschaftlich attraktiven Einspeisevergütungen für V2G
Hinzu kommt, dass die meisten in Deutschland verkauften E-Autos keine V2G-Funktion besitzen – im Gegensatz zu vielen chinesischen Modellen.
Die Rolle chinesischer E-Autos in Europa
Mit dem Markteintritt von Herstellern wie BYD, Leapmotor, SAIC oder NIO gelangen nun vermehrt Fahrzeuge mit serienmäßiger V2G-Unterstützung nach Europa. In Kombination mit neuen EU-Normen und wachsenden Smart-Grid-Initiativen könnte das ein Gamechanger für die Energiewende werden.
Prognose: Bis 2030 könnten in Europa über 15 Millionen V2G-fähige Fahrzeuge unterwegs sein – vorausgesetzt, Infrastruktur und Gesetzgebung ziehen mit.
Vorteile von Vehicle-to-Grid auf einen Blick
| Vorteil | Nutzen |
|---|---|
| Netzstabilisierung | Spannungsspitzen und Stromlücken können ausgeglichen werden |
| CO₂-Reduktion | Erneuerbare Energien lassen sich besser nutzen und speichern |
| Kosteneinsparung | Nutzer verdienen Geld oder sparen Stromkosten durch V2G-Modelle |
| Versorgungssicherheit | Dezentrale Speicher stärken das resiliente Netz |
| Wirtschaftliche Chancen | Neue Geschäftsmodelle für Energieanbieter, Flottenbetreiber und OEMs |
Fazit: China zeigt, wie V2G funktioniert – Deutschland sollte folgen
Während Deutschland noch über Normen, Pilotprojekte und Förderkulissen diskutiert, setzt China Vehicle-to-Grid bereits konkret um. Das liegt nicht nur an politischem Willen, sondern auch an der engen Verzahnung von Automobil- und Energiewirtschaft.
Mit der flächendeckenden Einführung von bidirektionalem Laden in China und der Exportwelle chinesischer E-Autos kommt die Technologie nun auch nach Europa. Für Deutschland ist das eine große Chance – und ein Weckruf.
Vehicle-to-Grid ist kein Zukunftskonzept mehr – es ist Teil der Energiewende. Wer jetzt die Voraussetzungen schafft, wird profitieren: ökonomisch, ökologisch und gesellschaftlich.
—
FAQ: Häufig gestellte Fragen zu Vehicle-to-Grid
- Was bedeutet V2G?
Vehicle-to-Grid (V2G) beschreibt das bidirektionale Laden, bei dem ein E-Auto Strom ins Netz zurückspeisen kann. - Gibt es V2G schon in Deutschland?
Ja, aber bisher nur in wenigen Pilotprojekten – die breite Einführung steht noch aus. - Welche E-Autos unterstützen V2G?
Viele Modelle aus China (z. B. BYD, NIO) sowie einige japanische (Nissan Leaf) sind bereits V2G-fähig. - Kann ich damit Geld verdienen?
Ja, bei entsprechender Infrastruktur und Vergütung – in China bereits bis zu 1.200 € pro Jahr.
Dr. Jens Bölscher ist studierter Betriebswirt mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Er promovierte im Jahr 2000 zum Thema Electronic Commerce in der Versicherungswirtschaft und hat zahlreiche Bücher und Fachbeiträge veröffentlicht. Er war langjährig in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt 14 Jahre als Geschäftsführer. Seine besonderen Interessen sind Innovationen im IT Bereich.